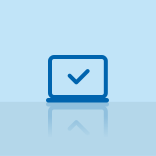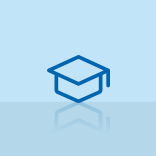Städte bereiten sich auf synthetische Opioide vor – Neues Projekt so-par aus dem Drogenbereich der Deutschen Aidshilfe
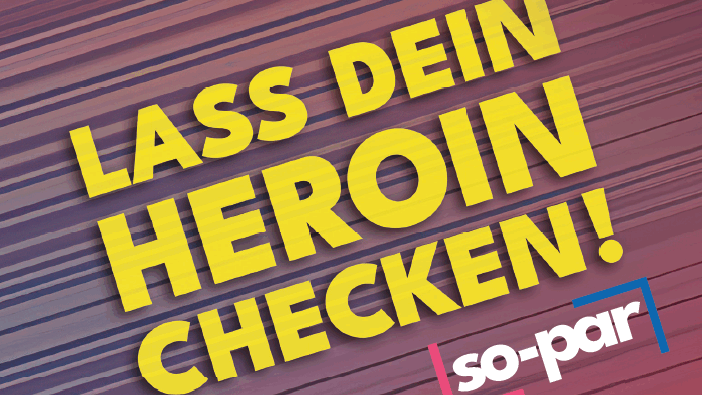

Maria Kuban, Leiterin des neuen kommunalen Projektes „so par“ der Deutschen Aidshilfe, das nutzer*innenorientiert mit einem klaren Zielfahrplan auf die synthetische Opioid-Verbreitung reagiert, stellt Hintergründe, Projektidee und Umsetzungsvorhaben vor.
Illegal hergestellte synthetische Opioide treten deutschlandweit in verschiedenen Städten vermehrt auf. Neben gefälschten Medikamenten oder sog. Research Chemicals sind infolge der Reduktion des Opium-Anbaus in Afghanistan vor allem Beimengungen synthetischer Opioide im Heroin eine Gefahr für Konsument*innen.
Um Todesfälle zu vermeiden, aber auch einer Verbreitung der Substanzen im Markt sowie einer Überforderung von Hilfe- und Gesundheitssystem vorzubeugen, gilt es, sich ein Lagebild zu verschaffen, Ansatzpunkte zur Eindämmung der Gefahren zu identifizieren und Strukturen zu schaffen, die im Krisenfall aktiviert werden können.
Der Name des Projekts stammt von „synthetic opioids – prepare and response„, also: „Syntehtische Opioide – Vorbereiten und Reagieren“. Das soll zunächst auf kommunaler / städtischer Ebene passieren: Mit drei teilnehmenden Projektstädten (Hannover, Berlin, Essen) werden Notfällpläne entwickelt, die in bestimmten Szenarien greifen. Dabei werden in jeweils einem Drogenkonsumraum der Stadt für Heroin-Konsument*innen Fentanyl- und Nitazen*-Schnelltests angeboten. So lassen sich Beimengungen niedrigschwellig erkennen und eine faktenbasierte Beratung zur Schadensminderung ermöglichen. Ausgewählte Proben werden zudem im Labor analysiert!
Hintergrund: Illegale synthetische Opioide tauchen auch in Deutschland vermehrt auf
Fentanyl, Nitazene und ähnliche Substanzen finden immer mehr Verbreitung: Als Beimengung in Heroin und anderen Drogen, in Form gefälschter Medikamente und als bewusst konsumierte Substanz. Die Opioide sind billig herzustellen und leichter zu schmuggeln als Heroin. Zudem wird in Afghanistan der Schlafmohnanbau unterbunden – synthetische Substanzen füllen die Lücke. Die Substanzen aus dem Labor haben eine sehr starke, kaum berechenbare Wirkung. Das Risiko für tödliche Überdosierungen ist hoch.
Besonders für Menschen, die täglich Heroin konsumieren, sind diese Stoffe eine große Gefahr. Die Potenz ist um ein Vielfaches höher als die von Heroin. Werden sie Heroin beigemengt (zum Beispiel, um die Wirkung zu verstärken oder den niedrigen Wirkstoffgehalt im Heroin zu kompensieren), genügen schon salzkorngroße Mengen, um selbst bei erfahrenen Konsument*innen eine Überdosierung hervorzurufen. Erkennbar an Aussehen, Geruch oder Geschmack sind sie dabei nicht.
In Kanada wurde Heroin durch zunehmende Beimengungen nach und nach vom Markt verdrängt. Die Anzahl an Drogentodesfällen ist erschreckend: seit der zunehmenden Verfügbarkeit von Fentanyl sind über 50.000 Menschen in Kanada an opioidbedingten Überdosierungen verstorben, davon knapp 75% an Fentanyl.[1] In den USA mündete die sogenannte Oycontin-Krise, die auf die verantwortungslose Verschreibung hoch potenter Medikamente zurückgeht, ebenfalls in einen gewaltigen Schwarzmarkt von Opioiden und verantwortet allein im Jahr 2023 über 105.000 Todesfälle.[2]
Die Situationen in den beiden Ländern sind kaum vergleichbar mit der Ausgangssituation in Deutschland. Aber wir können und sollten aus diesen Krisen lernen. Estland, das in den frühen 2000er Jahren ein ähnliches Phänomen erlebte, wie wir in Deutschland jetzt beobachten, hat 2017 die Fentanylkrise als bewältigt erklärt. Und auch in Kanada wurden zentrale Maßnahmen zur Vermeidung von Todesfällen in einem Umfang ausgebaut, von dem wir hier nur träumen können.
Ein Beispiel ist die Vergabe von Take-Home-Naloxon. Naloxon ist das lebensrettende Notfallmedikament, das bei Verabreichung eine Opioid-Überdosierung nahezu unmittelbar aufhebt. Als Take-Home-Naloxon wird das Medikament dann bezeichnet, wenn man es außerhalb medizinischer Kontexte erhalten, mit sich führen und abgeben kann. In Kanada ist es deshalb überall in der Nähe von offenen Drogenszenen erhältlich, u.a. in Automaten (in denen es sonst Süßigkeiten, Getränke oder ggf. Konsumutensilien 24-7 gibt). In Deutschland sollen zwar gesetzliche Rahmenbedingungen bald verändert werden, aktuell ist die Verbreitung und somit Einsatzbereitschaft des Naloxon-Nasensprays allerdings durch strenge Verschreibungsregeln und u.a. ärztliche Vorurteile sehr limitiert. Sollten stärkere Opioide im Umlauf sein und es zu mehr Überdosierungen kommen, wäre Deutschland schlecht vorbereitet, obwohl anderes möglich wäre.
Projektidee: Wer kann dazu beitragen, eine Opioidkrise zu verhindern?
Es sind bereits jetzt die tragenden und maßgeblichen Angebote bekannt, die eine bessere Versorgung und somit ggf. auch verringerte Mortalität von Opioidgebraucher*innen ermöglichen können
- Die Ausstattung medizinischer Laien mit Naloxon-Nasenspray
- Möglichkeiten von Substanzanalyse und/oder Drug Checking
- Ein niedrigschwelliger Zugang zur Substitutionsversorgung und zu Drogenkonsumräumen sowie Frühwarnsysteme
Für all diese Maßnahmen sind bundesweit die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um sie flächendeckend um- und einzusetzen. Zudem hat die Bundesregierung in verschiedenen Zusammenhängen das Bundesinteresse signalisiert, sich auf synthetische Opioide vorzubereiten. Darauf hat der neue Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck in der Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Zahlen von Menschen, die 2024 an den Folgen von Drogenkonsum verstorben sind, verwiesen.[3]
Im nächsten Schritt braucht es die Handlungsbereitschaft der Bundesländer um u.a. Rechtsverordnungen zu erlassen oder die finanziellen Mittel bereitzustellen. Drug Checking ist zum Beispiel gesetzlich möglich, bedarf aber eine Landesverordnung, die die Umsetzung regelt, bevor es dann auch wirklich angeboten werden kann. Ähnlich ist es bei Städten und Kommunen, die vor Ort ein Hilfesystem aufbauen, erhalten und stärken müssen, aber auch können.
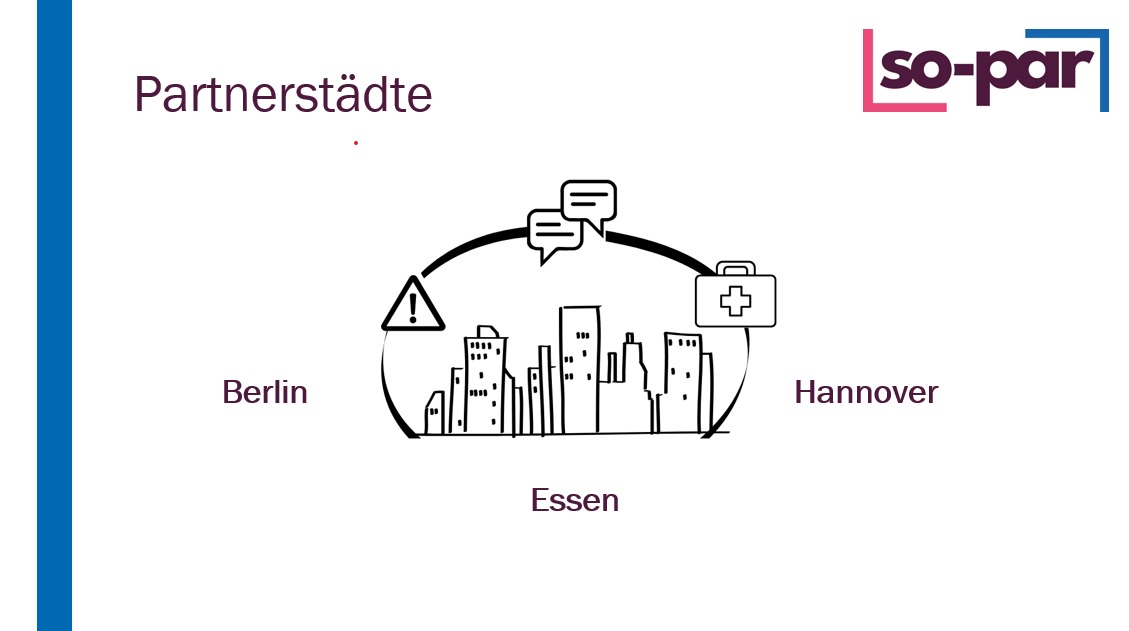
Städte und Kommunen sind auch als unterste Katastrophenschutzbehörde zu verstehen. Hier werden Veränderungen zuerst sichtbar und hier ist die Anpassung von Maßnahmen zuerst erforderlich. Und hier setzt das neue Projekt so-par an. Zusammen mit dem Deutsch-Europäischen-Forum für Urbane Sicherheit (DEFUS) setzt der Fachbereich Drogen der DAH im Zeitraum April 2025 – März 2027 das Projekt mit den drei Städten Berlin, Essen und Hannover um.
Die Kernelemente von so-par sind:
- Die Erstellung von Notfallplänen in der jeweiligen Stadt. Hierbei soll ein Konzept für die Krisenkommunikation erarbeitet werden – ähnlich zu Szenarien wie Hochwasser oder Seuchenschutz. Konkret werden Szenarien festgelegt: ab wann tritt ein Notfallplan in Kraft, z.B. wenn es Funde bei Drug Checking oder Sicherstellungen von synthetischen Opioiden gibt oder wenn es Überdosierungen mit synthetischen Opioiden gibt), davon ausgehend ein Kommunikationsplan (wer sagt wem Bescheid) und letztendlich die Maßnahmen, die daraufhin in Kraft treten müssen (z.B. Warnungen).
- Das Angebot von Substanzanalyse in Drogenkonsumräumen. Hierbei wird Heroinkonsument*innen angeboten, ihr mitgebrachtes Heroin im Konsumraum auf die Beimengung von Fentanyl und Nitazenen checken zu lassen. Bei positiven Schnelltests erfolgt eine Konsumberatung, die Konsument*innen eine informierte Entscheidung ermöglicht. Außerdem werden einzelne Proben im Labor untersucht, um sich ein Lagebild zu verschaffen.
- Das Ausstatten diverser Berufsgruppen wie z.B. Streetwork-Teams, Polizei und Ordnungsbehörden mit Naloxon.
- Das Bereitstellen aller Informationen und bereits erarbeiteter Abläufe an alle interessierten Städte und Organisationen.
Ziel ist es, die drei Projektstädte auf das vermehrte Aufkommen synthetischer Opioide vorzubereiten und darüber hinaus alle Erkenntnisse für andere Städte und Kommunen nutzbar zu machen, sodass auch andere Städte zum Beispiel ein Krisenkommunikationskonzept erarbeiten können.
Die Infos zum Projekt werden regelmäßig aktualisiert und erweitert im neuen Drogenportal der Deutschen Aidshilfe https://www.aidshilfe.de/drogen/sopar.
[1] Siehe health-infobase.canada.ca
[2] Siehe nida.nih.gov
Weitere Links und Kontakt
- Drogenportal der Deutschen Aidshilfe https://www.aidshilfe.de/drogen/sopar.
- Leiterin Maria Kuban, Deutsche Aidshilfe, maria.kuban@dah.aidshilfe.de
Diesen Beitrag teilen