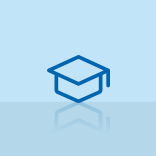LGBTI und psychische Erkrankungen

Schwule, lesbische und bisexuelle Menschen sind – im Vergleich zu Heterosexuellen – signifikant häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen [1]. Woran liegt das? Und was können wir als Community dagegen tun?
Ein Beitrag aus HIV-Beratungaktuell 2020/2
Im Kern sagen soziologische Theorien wie das Minderheiten-Stress-Modell [2] und das Syndemische Modell [3], dass sexuelle Minderheiten grundsätzlich die gleiche psychische Gesundheit mitbringen wie andere Menschen. Aber viele erleiden eine oft jahrelang andauernde Belastung durch negative Reaktionen der Gesellschaft auf die Sichtbarwerdung ihrer nicht-heterosexuellen Identität. Diskriminierung, Ablehnung, Gewalterfahrungen, aber auch Stress, der mit dem Verbergen der sexuellen Orientierung verbunden ist, schafft einen intensiven „Minority-Stress“. Dieser kann sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken.
Stigmatisierung begünstigt die Entwicklung psychischer Störungen
Erfahrungen von Stigmatisierung und Diskriminierung können auch dazu führen, dass Menschen negative Werturteile der anderen irgendwann selbst annehmen („Verinnerlichte Stigmatisierung“ oder „Internalisierte Homonegativität“). Dies ist dann ein weiterer Faktor, der psychisch destabilisieren und das Gesundheitsverhalten negativ beeinflussen kann. Die (internalisierte) Abwertung des eigenen Begehrens kann in Folge auch selbstschädigenden Substanzkonsum fördern. „Das Zusammenspiel der verschiedenen Risikofaktoren kann zu einem Schneeballeffekt führen, bei dem verschiedene psychische und andere gesundheitliche Probleme sich wechselseitig verstärken“, sagt Psychologe Martin Plöderl [1].
Auch die schwule Szene kann stressen

Eine aktuelle multi-methodische Studie zeigt, dass auch die schwule Community krankmachenden Stress, sogenannten „Intra-Gay-Community-Stress,“ erzeugen kann [4]. Die hohe Bedeutung von Statusaspekten (z.B. Männlichkeit, Attraktivität, Besitz materieller Güter) kann über den „traditionellen Minderheitenstress“ hinaus stressen.Die Autoren der Studie empfehlen, dass Institutionen, die Angebote für die Community vorhalten, dazu beitragen sollten, soziale Bindungen und Vertrauen zu stärken, um so den (intergenerationalen) Community-Zusammenhalt zu fördern. Weiterhin sollten spezifische Interventionen weitere Stressoren, die sich aus dem Wettbewerbsdruck ergeben, aufgreifen. So beschreibt Stuart eine spezifische szeneimmanente Abwertungskultur, die auf bestimmten Körpernormen und Männlichkeitsvorstellungen basiert. Außerdem stellt die „Selbstvermarktung“ in der digitalisierten Dating-Kultur für viele eine Herausforderung dar [5,6].
Diskriminierung von sexuellen Minderheiten noch immer aktuell
Wird in unserer Gesellschaft über das Thema „Diskriminierung von LGBTI“ diskutiert, hört man häufig, dass es Schwule und Lesben heute doch sehr viel leichter in der Gesellschaft haben und es eigentlich keine Diskriminierung mehr gäbe. In ihrem Vortrag auf der Jahrestagung der DGPPN im November 2019 zeigte Liselotte Mahler von der Berliner Charité auf, dass Diskriminierung mit Auswirkung auf die psychische Gesundheit von LGB kein Thema der Vergangenheit ist. LGB-Jugendliche erleben deutlich mehr Gewalterfahrungen, Missbrauch und Mobbing. Homo- und Trans*negatives Mobbing ist, so Mahler, nicht nur die häufigste Form, sondern auch stärker mit Suizidgedanken der Opfer verbunden als andere Formen des Mobbings. 70 % der Jugendlichen, zitiert sie die Studie des deutschen Jugendinstituts, hatten noch 2014 Angst vor ihrem Coming-Out.
Depression und HIV
Menschen mit HIV haben häufiger als andere mit Depressionen zu tun. Je nach Studie findet sich in Gruppen von Menschen mit HIV eine Häufigkeit zwischen 20-40 %. Ob die Gründe am Minderheitenstress liegen (z.B. in der Rolle als schwuler Mann, Drogengebraucher*in, Migrant*in), an der fordernden und jahrelangen Auseinandersetzung mit der chronischen Erkrankung sowie Reaktionen aus dem sozialen Umfeld oder am Virus selbst, ist umstritten. Vermutlich ist es eine Mischung aus vielem. Auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam 2018 präsentierten niederländische Forscher*innen eine Studie, in der das psychische Wohlbefinden von Menschen mit HIV und Menschen mit chronischer Diabetes und der Restbevölkerung verglichen wurde. Menschen mit HIV gaben dabei an, sich körperlich ähnlich fit und wohl zu fühlen wie die Allgemeinbevölkerung. Allerdings ergab die Befragung in der Gruppe der Menschen mit HIV wesentlich schlechtere Werte bei Fragen zu emotionaler Verfasstheit und Depressivität. Vor allem bei Menschen, die ein starkes Stigma empfinden, sei die mentale Verfassung besonders schlecht gewesen. Somit erscheint die Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Stigmatisierung auch hier ein zentraler Schlüssel zur Erklärung der erhöhten Prävalenz psychischer Störungen zu sein [7].
Verhältnisprävention gegen psychische Erkrankungen
Wichtig bleibt allerdings auch zu sagen, dass der überwiegende Teil der LGBTI-Community und der Menschen mit HIV es schafft, den zusätzlichen Minderheitenstress zu bewältigen und keine psychische Erkrankung zu entwickeln. Dies liegt vermutlich an den Schutzfaktoren (Resilienz), die Menschen mitbringen: sichere Bindungserfahrungen, ein gutes soziales Netzwerk oder die Fähigkeit, mit negativen Erfahrungen produktiv umzugehen und sich auch gezielt positive Momente ins Leben zu holen. Und diese Schutzfaktoren haben natürlich auch LGBTI.
Die LGBTI-Community hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Resilienz ihrer Mitglieder. Sie kann eine soziale Unterstützung bieten und ermöglichen, dass Menschen aus alten Verletzungen herauswachsen. Auch wenn die Community nie ein verletzungsfreier Ort war und sein kann, bietet sie jedoch meist vor allem eines: die Akzeptanz der sexuellen Identität ihrer Mitglieder – und stellt so ein nicht zu unterschätzendes Gegengewicht zum minority stress dar. Verhältnisprävention bedeutet, solche Orte der Unterstützung zu stärken und selbstwertschädigenden Entwicklungen innerhalb der Community entgegenzuwirken. Verhältnisprävention bedeutet aber auch, der Diskriminierung und Stigmatisierung aller LGBTI in der Gesamtgesellschaft weiterhin beständig entgegenzutreten: politisch und auch ganz konkret – sei es in der außerschulischen Bildungsarbeit, in HIV-Fortbildungen für Pflegekräfte sowie Arbeitsämter oder durch Zeigen von Haltung in der alltäglichen Beratung und Betreuungsarbeit. Die unterschiedlichen Prävalenzen für psychische Erkrankungen zwischen Heterosexuellen und LGBTI zeigen, dass diese Arbeit noch immer Not tut.
Steffen Taubert, Dirk Sander
Quellen
[1] Plöderl M, Kralovec K Fartacek C, Fartacek R.(2009). Homosexualität als Risikofaktor für Depression und Suizidalität bei Männern. Blickpunkt der Mann 2009; 7 (4
[2] Meyer, I. H. (2003). Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: conceptual issues and research evidence. Psychological Bulletin, 129, 674–697.
[3] Stall, R., Friedman, M., & Catania, J. A. (2008). Interacting epidemics and gay men’s health: a theory of syndemic production among urban gay men. In: Wolitski, R. J., Stall, R., & Valdiserri, R. O. (Hrsg.), Unequal opportunity: health disparities affecting gay and bisexual men in the United States (S. 251–274). New York: Oxford University Press.
[4] Pachankis, J. E., Clark, K. A., Burton, C. L., Hughto, J. M. W., Bränström, R., & Keene, D. E. (2020,January 13). Sex, Status, Competition, and Exclusion: Intraminority Stress From Within the GayCommunity and Gay and Bisexual Men’s Mental Health. Journal of Personality and SocialPsychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/pspp0000282
[5] Shewey, D. (2018). The Paradox of Porn. Notes on Gay Male Sexual Culture. New York: Joybody Books.
[6] Stuart, D. (2019) „Chemsex: origins of the word, a history of the phenomenon and a respect to the culture“, Drugs and Alcohol toda, vol 19, issue 1, pp.3-10
Diesen Beitrag teilen