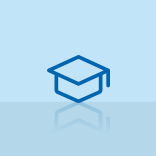HIV und Schuldgefühle

Ein Interview von Martin Thiele, Aidshilfe Halle, mit Franziska Hartung
Die Autorin Franziska Hartung spricht mit uns über ihr Buch „HIV und Schuldgefühle – Zur Psychodynamik in der HIV-Testberatung“, das im September im Psychosozial-Verlag erschienen ist.
Ein Beitrag aus HIV-Beratungaktuell 2021/1
Du erforschst in deinem Buch HIV und Schuldgefühle. Warum ist das ein wichtiges Thema und wie bist du dazu gekommen?

Zu Beginn der „Aids-Epidemie“ in den 1980er Jahren kam eine HIV-Infektion nicht nur einem Todesurteil gleich, sondern sie wurde auch mit einem Stigma von „Schuld“ und „Strafe“ für abweichendes Sexualverhalten belegt. Nun könnte man meinen, das sei heute kein Thema mehr. Aber während meiner Tätigkeit in der HIV-Testberatung im Gesundheitsamt Leipzig habe ich häufig erlebt, dass Menschen, die befürchten, sich mit HIV infiziert zu haben, enorme Schuldgefühle und Ängste vor sozialer Ächtung haben. Trotz der modernen HIV-Therapie, der neuen Präventionsmöglichkeiten (Schutz durch Therapie und PrEP) und der jahrzehntelangen Aufklärungs- und Anti-Diskriminierungsarbeit der Community, ist HIV offenbar noch immer mit alten – aber auch neuen – stigmatisierenden Bildern verknüpft. Und das spüren Menschen, wenn sie sich (potentiell) infiziert haben.
Wo sind dir in der HIV-Testberatung Schuldgefühle begegnet?
Neben befürchteten Schuldzuweisungen spielte in der Beratung auch oft der (Selbst-)Vorwurf der Verantwortungslosigkeit eine Rolle, wenn z.B. gegen die Regeln des Safer-Sex verstoßen wurde oder eventuell andere Personen „gefährdet“ wurden. Zudem habe ich beobachtet, dass Risiken völlig anders bewertet werden, wenn eine vermeintliche Ansteckungssituation schuldhaft erlebt wird, z.B. beim „Fremdgehen“ oder beim Sex im Bordell. Manchmal hatte ich als Beraterin auch das Gefühl, ich nehme die Beichte ab. Diese Zusammenhänge in Bezug auf HIV und Schuld haben mich interessiert. Und da es bisher kaum wissenschaftliche Forschung darüber gibt, wollte ich etwas dazu beitragen.
Trotz der modernen HIV-Therapie, der neuen Präventionsmöglichkeiten (Schutz durch Therapie und PrEP) und der jahrzehnte-langen Aufklärungs- und Anti-Diskriminierungsarbeit der Community, ist HIV offenbar noch immer mit alten – aber auch neuen – stigmatisierenden Bildern verknüpft.
Wie bist Du in deiner Arbeit vorgegangen, was waren Deine Forschungsfragen?
HIV, als sexuell übertragbare Infektion, stellt eine Art Folie dar, auf die persönliche und gesellschaftliche (Moral-) Vorstellungen und Ängste in Bezug auf Sexualität projiziert werden. Schuldgefühle können uns auf der subjektiven Ebene über diese Normen und Moralvorstellungen Auskunft erteilen, denn sie entstehen dann, wenn gegen diese Regeln verstoßen wird. In einer qualitativen Forschung mit Klient*innen der HIV-Testberatung habe ich daher untersucht, auf welche persönlichen, normativen und moralischen Orientierungen sich die Schuldgefühle beziehen und welche Rolle dabei die HIV-Infektion, die Bewertung des Ansteckungsrisikos, der Umgang mit Risiken („Risikomanagement“) und das HIV-Testprozedere spielen.
Was sind nun die zentralen Ergebnisse Deiner qualitativen Studie und was hat es mit den „Schuld-Typen“ auf sich?
HIV-bezogene Schuldgefühle stellen eine komplexe Gemengelage aus verschiedenen Aspekten dar. Aus der qualitativen Analyse konnten schließlich sechs Schuld-Typen gebildet werden, welche die verschiedenen Anteile des Schuldgefühls und die zugrundeliegenden Dynamiken veranschaulichen. Diese Typenbildung kann helfen, die Schuldgefühle besser einzuordnen. Zusammen-fassend können Schuldgefühle als ein innerpsychisches Instrument des „moralischen Risikomanagements“ bezeichnet werden, weil sie unser Verhalten regulieren und uns im Inneren anzeigen, wenn wir gegen präventive, moralische oder persönliche Normen verstoßen haben. Schuldgefühle können aber auch irrational und chronisch sein und im schlimmsten Fall die gesamte Sexualität beeinträchtigen. Beispielsweise, wenn Sex immer mit der Angst vor HIV verbunden ist und dann schuldhaft (weil potentiell infektiös) erlebt wird. Oder wenn der Sex, den man gerne hätte, schuldhaft (weil potentiell unmoralisch) erlebt wird und die Angst vor HIV dann eine Stellvertreterfunktion erfüllt. Ebenso können Schuldgefühle auch mit einer verzerrten Risikowahrnehmung und übersteigerten HIV-spezifischen Ängsten in Zusammenhang stehen sowie das Testverhalten und -erleben beeinflussen. So sind der HIV-Test und die Beratung mit einer Reihe (symbolischer) Bedeutungen aufgeladen, wie die der „Absolution“ oder „Beichte“.
HIV, als sexuell übertragbare Infektion, stellt eine Art Folie dar, auf die persönliche und gesellschaftliche (Moral-) Vorstellungen und Ängste in Bezug auf Sexualität projiziert werden.
Was siehst du als Folgen des alten Aids-Diskurses und was ist heute anders?
Die Schuldgefühle rühren zum einen aus dem hartnäckigen Fort-bestehen der mit dem „alten“ Aids-Diskurs verbundenen Stigmatisierung und Schuldzuschreibung in Bezug auf „Risikogruppen“. Andererseits hat sich die Schuld heute scheinbar subjektiviert. Es ist z.B. mehr die Rede von „Selbst- und Fremdverantwortung“ und „Risikomanagement“ als von „Schuld“ und „Strafe“. Wir wollen heute eine verantwortliche, sichere und gesunde Sexualität leben, aber auch eine lustvolle. Die Präventionsbotschaften haben also gewirkt und sich verinnerlicht. Das ist auch gut so, aber es werden auch neue Normen gesetzt. Und dieser Spagat zwischen Lust und Infektionsvermeidung ist manchmal gar nicht so einfach und kann zu Schuldgefühlen führen, wenn wir uns „nicht präventiv genug“ verhalten.
Also hat die HIV-Prävention auch einen Anteil an den Schuldgefühlen?
Die HIV-Prävention muss im Sinne der Infektionsvermeidung Möglichkeiten anbieten, wie wir uns schützen können und uns „richtig“ und „präventiv“ verhalten. Daher setzt sie immer Verhaltens-Regeln fest. Ein Beispiel hierfür ist die (moralische) Bedeutung des Kondoms. Es hat lange gedauert, Sex mit Kondom als „normal“ und „verantwortungsvoll“ zu etablieren. Vielleicht haben wir uns u.a. deswegen so schwer getan mit der Akzeptanz des „Safer-Sex 3.0“? Gerade in den anfänglichen Debatten um das Bewerben von „Schutz durch Therapie“ und die Kostenübernahme der PrEP, war häufig der Vorwurf der Verantwortungslosigkeit (auch gegenüber dem Sozialstaat) zu hören, wenn es um möglichen Sex ohne Kondom ging – nicht nur in der Allgemeinbevölkerung, auch innerhalb der HIV-Community.
Welche Rolle spielt dabei unser Verständnis von Gesundheit?
Aktuelle Diskurse um Gesundheit und „Eigenverantwortung“, die auch die HIV-Prävention tangieren, spielen eine weitere Rolle. Gesundheit wird heute mit Attributen wie „Glück“, „Freiheit“ und „Leistung“ assoziiert, wie es sich in der neoliberalen Prämisse der „Selbstoptimierung“ ausdrückt. Wenn diesen Gesundheitsforderungen nicht nachgegangen wird, kann dies zu Schuldgefühlen führen. Sei es, weil man es „nicht geschafft hat“, sich zu schützen, weil man „wegen ein paar Minuten Spaß“ seine Gesundheit „aufs Spiel gesetzt“ hat oder aufgrund der Kostenübernahme der Medikamente das Sozialsystem belastet. (Sexuelle) Gesundheit sollte zudem nicht nur als die Abwesenheit von körperlicher Krankheit gedacht werden. Auch sexuelle Zufriedenheit und psychische Gesundheit sind wichtig. Gut ist, dass die HIV-Prävention das auch mit im Blick hat.
Würdest du sagen, dass es auch ganz allgemein einen Zusammenhang zwischen Sexualität und Schuld gibt? Inwiefern haben z.B. Phänomene wie slut shaming oder andere Abwertungen bestimmten sexuellen Verhaltens mit dem Phänomen HIV und Schuld zu tun?
Der Zusammenhang zwischen Sexualität und Schuld ist tief verwurzelt in unserer Kulturgeschichte. Die Verknüpfung von Sexualität und Schuld hat bereits in der Schöpfungsgeschichte, im sogenannten Sündenfall ihren Ursprung. Der Begriff Sünde ist in der christlichen Glaubenslehre stark mit der lust- und triebhaften Seite der Sexualität verknüpft. Zum einen wird die Sexualität durch die Kirche mit einer großen Bedeutsamkeit und Schuld belegt und gleichzeitig bietet sie Möglichkeiten an, wie sie uns von dieser Schuld befreien kann: Die Beichte. Beichtpraxen spielen aber nicht nur im religiösen Kontext eine Rolle. Sie finden sich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Ein Beispiel sind die vielfältigen Zwangsberatungen im Bereich der Sexualität. Sei es die Pflichtberatung im Bereich des neuen Prostituiertenschutzgesetzes, das Begutachtungsverfahren im Rahmen des „Transsexuellengesetzes“ oder die Pflichtberatung bei einem „Schwangerschaftskonflikt“. Mit der Festsetzung des Schwangerschaftsabbruchs im Strafgesetzbuch ist dieser nicht nur moralisch mit Schuld belegt, sondern auch rechtlich. Zudem wird in unserer Gesellschaft bestimmtes Sexualverhalten nach wie vor abgewertet. Beispielhaft ist
die Abwertung von weiblicher und homosexueller Promiskuität („Slutshaming“). Die Doppelmoral führt sich hier fort. Und schließlich lässt sich auch wieder der Kreis in Bezug auf HIV schließen, denn HIV wird nach wie vor – und das zeigt auch meine qualitative Analyse – mit weiblicher und homosexueller Promiskuität verknüpft und abgewertet.
Bist du in deiner Forschung auf etwas gestoßen, das dich besonders überrascht oder beeindruckt hat?
Es hat mich sehr beschäftigt, dass zwei junge, schwule Männer in meiner Studie berichten, dass sie in „Outing“-Situation in Bezug auf ihre Homosexualität von Familie und Freunden als erstes da-rauf angesprochen wurden, dass sie in Bezug auf HIV vorsichtig sein sollen. Natürlich kann man sagen, dass Männer*, die Sex mit Männern* haben (M*SM*) ein statistisch höheres Risiko für HIV haben, aber dies rezipiert auch das alte Stigma „HIV als Schwulenkrankheit“. Mir ist noch einmal bewusst geworden, welche individuelle, aber auch kollektive Last für schwule Menschen das zur Folge hat. Es suggeriert, dass sie eine besondere Verantwortung hätten, sich (und die Allgemeinbevölkerung) zu schützen. Ich würde diese Verantwortung gerne auf alle Menschen verteilt wissen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Vor allem, da die Infektionszahlen bei schwulen Männern* und M*SM* konstant sinken, während sich heterosexuelle Menschen von dieser Thematik nicht berührt fühlen und HIV in dieser Gruppe häufig erst in einem späten Stadium entdeckt wird.
Die Themen Schuld und Verantwortung müssen in Prävention und Beratung auch aktuell mitgedacht werden, ohne diese auf das Erbe des alten Aids-Diskurses zu reduzieren.
Was für eine Entwicklung, welche Veränderungen wünschst du dir diesbezüglich?
Die Themen Schuld und Verantwortung müssen in Prävention und Beratung auch aktuell mitgedacht werden, ohne diese auf das Erbe des alten Aids-Diskurses zu reduzieren. Insbesondere mit dem Blick auf ein ganzheitliches Verständnis sexueller Gesundheit empfinde ich es als notwendig, die normativen Botschaften der HIV-Prävention selbst in den Blick zu nehmen und Präventionsmaßnahmen neben dem Ziel der Infektionsvermeidung verstärkt auch auf sexuelle Zufriedenheit auszurichten. Entstigmatisierung sollte dabei nach wie vor Priorität haben. Dies bezieht sich aber nicht alleine auf HIV, sondern auch auf Sexualverhalten, das gesellschaftlich abgewertet wird, wie weibliche und homosexuelle Promiskuität sowie auf soziale Minderheiten, die mit HIV in Verbindung gebracht werden, wie M*SM*, Trans*- und Inter*Personen, Sexarbeitende und (Black) People of Color.
Glaubst du, wir können auch bei uns selbst solche Schuldgefühle abbauen? Was wären dafür Anfänge/Strategien?
Ich denke Schuldgefühle sind menschlich und wir können und sollten uns nicht generell davon befreien. Denn sie sind gewissermaßen unser innerer ethischer Kompass. Jedoch kommt es auf den Ursprung der Schuldgefühle an. Geben sie uns Auskunft über etwas, das wir in unseren Augen tatsächlich falsch gemacht haben und das uns selbst enttäuscht? Oder beruhen sie auf antizipierten Schuldzuweisungen und Moralvorstellungen, die wir selbst nicht teilen? Oder sind es irrationale Schuldgefühle, deren Ursprung überhaupt nicht mehr für uns auszumachen ist, weil sie sich im Verlauf unserer Sozialisation in unsere Psyche eingeschrieben haben? Das ist nicht immer einfach zu trennen, aber den Grund der Schuldgefühle zu erforschen, kann dabei hilfreich sein. Generell sollten wir fehlerfreundlicher zu uns selbst und gegenüber anderen sein und mehr über Fragen von Verantwortung, insbesondere in Bezug auf Safer Sex sprechen. Kommunikation, insbesondere über Sexualität, ist für mich der Schlüssel. Und das hilft auch, Tabus in unseren Köpfen und in der Gesellschaft abzubauen.

Franziska Hartung, M.A. Angewandte Sexualwissenschaft, Dipl.-Soz.-Päd., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und forscht in Kooperation mit der Deutschen Aidshilfe zu HIV-bezogener Stigmatisierung und Diskriminierung im Forschungsprojekt „positive stimmen 2.0“. Sie ist Lehrbeauftragte an der Hochschule Merseburg und Referentin für sexuelle Bildung. Zuvor war sie in der HIV- und STI-Beratung im Gesundheitsamt Leipzig sowie in der Schwangerschafts-(Konflikt)Beratung beim Deutschen Roten Kreuz Leipzig tätig.
Diesen Beitrag teilen